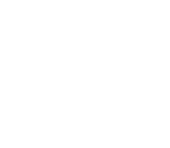1. Einleitung
Johann Heinrich ZANG wurde 1733 in Zella-Mehlis geboren und starb 1811 in Würzburg. Die längste Zeit seines Lebens, nämlich von 1752 bis 1801, war er Lehrer und Kantor in Mainstockheim bei Kitzingen. Sein Orgelmacherbuch erschien zuerst 1804 in Nürnberg im Verlag Schneider und Weigel unter dem Titel
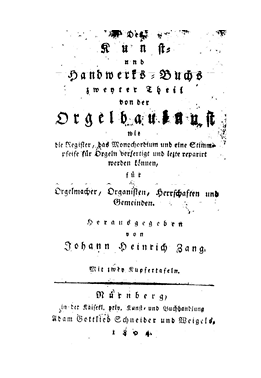
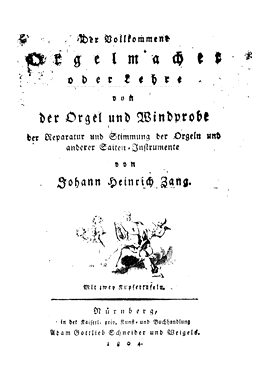
„Der Vollkommene Orgelmacher oder Lehre von der Orgel und Windprobe der Reparatur und Stimmung der Orgeln und anderer Saiteninstrumente [?] von Johann Heinrich Zang.“,
und zwar als zweiter Band des Handwerksbuches, dessen erster Band von 1790 der Küferlehre gegolten hatte. Als dieser zweite Band hat das Buch noch einen eigenen Titel, der dem o.e. vorangestellt ist:
„Des Kunst- und Handwerks-Buchs zweyter Theil von der Orgelbaukunst wie die Register, das Monochordium und eine Stimmpfeife für Orgeln verfertigt und letzte reparirt werden können, für Orgelmacher, Organisten, Herrschaften und Gemeinden. Herausgegeben von Johann Heinrich Zang.“
Dass ZANG sich hier als Herausgeber bezeichnet, lässt darauf schließen, dass er wohl zusammen mit anderen ihm geeignet erscheinenden Autoren eine Enzyklopädie des Handwerks schaffen wollte und an die Fortsetzung der Reihe dachte. Dazu ist es offenbar nicht gekommen, es sind nur die Küferlehre und der Orgelmacher erhalten; ein dritter Band wird im Orgelbauerbuch erwähnt, ist aber nirgends auffindbar.
Das Orgelmacherbuch muss aber recht erfolgreich gewesen sein, denn 25 Jahre später (und 18 Jahre nach ZANGs Tod) erschien das Buch 1829 in zweiter Auflage, wieder in Nürnberg im Verlag Schneider und Weigel, unter dem Titel „Der Vollkommene Orgelmacher oder Lehre von der Orgel und Windprobe der Reparatur und Stimmung der Orgeln und anderer Tasten-Instrumente von Johann Heinrich Zang.“. Abgesehen von der Korrektur des Druckfehlers bei den Tasteninstrumenten fehlt nun der Bezug auf die Handwerkslehre; offenbar war dieses Projekt inzwischen aufgegeben worden. Außerdem ist das Vorwort weggelassen.
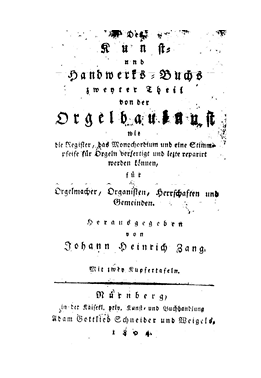
Wer ein praktisches Lehrbuch des Orgelbaus um 1800 erwartet, wird möglicherweise enttäuscht sein. Das Buch war nicht für Orgelbau-Lehrlinge gedacht, und obwohl es auf viele handwerkliche Einzelheiten eingeht, werden heutige Hobby-Instrumentenbauer ihm nicht die Kniffe und Mensurtafeln entnehmen können, die sie suchen. Wenn man also den Orgelbau daraus nicht lernen kann, wozu soll das Buch dann dienen?
Adressaten sind zunächst einmal die Berufskollegen ZANGs, die Kantoren und Organisten, vornehmlich wohl die der kleinen Städte und größeren Dörfer. Ihnen sind
- die für den Umgang mit ihrem Instrument nötigen Kenntnisse zu vermitteln,
- die schlimmsten Unarten beim gottesdienstlichen Orgelspiel((v.a. die Verwendung von Tanzmusik, „den ärgerlichen Menuetten, Polonaisen, Deutsch- und Schleifertänzen …, indem sich ein Organist durch lezte, bei vernünftigen Leuten nur verächtlich macht, das Kirchenvorsteher ernstlich abzustellen suchen solten“ (Vorrede 1804, Bl. 5v.). Als abschreckenden Beispiel berichtet ZANG (Bl. 5): „Ich habe öfters, (freilich waren es nur gemeine Organisten) mit angehört, daß man bei Trauerliedern, bekannte Bauerntänze und zwar aus der Terz der Melodie, vorludelte, und darauf mit einer unleidlichen Cadenz, sich in den Hauptton warf, was hier vor eine Andacht erwecken soll, das mögen Vorsteher und Geistliche solcher Orte beurtheilen.“)) auszutreiben,
- ein Stück der zeitgenössischen musikalischen Bildung zu verschaffen((Musiktheoretische Bücher gab es in großer Zahl, z.B. Jacob ADLUNGs auch von ZANG zitierte, geradezu enzyklopädische „Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit“ von 1758, ein Band von über 800 Seiten, in dem nahezu alle musikalischen Fragen abgehandelt werden, die ZANG erwähnt)),
- die Argumente an die Hand zu geben, mit denen sie bei ihren Kirchengemeinden Beschaffung und Ausbau einer vernünftigen Orgel durchsetzen konnten.
Die zweite Gruppe Adressaten sind „Herrschaften und Gemeinden“, die nämlich die Instrumente der Organisten bezahlen und unterhalten müssen. Sie sollen lernen oder nachschlagen können, worauf es bei Neubau und Reparatur einer Orgel ankommt,
„weil manche Herrschaft und Gemeinde, welche neue Orgeln bauen, oder alte reparieren lassen, durch Stümpler betrogen und durch immerwährendes repariren und flicken, in den größten Schaden versezt werden“((Vorrede 1804, Bl. 2v.)),
und woran sie einen verlässlichen Orgelbauer von einem „Stümpler“ unterscheiden können. Auch heute ist dies ein legitimer Zweck für ein Buch((vgl. z.B. die Vorrede (1937) von Hans KLOTZ zu seinem inzwischen weit verbreitetem „Buch von der Orgel“: Er wendet sich „… nicht nur [an] Organisten …, sondern auch … [an] Architekten, die sich beim Entwurf eines Kirchbaus mit den Gegebenheiten der Orgel befassen müssen, Pfarrer und Kirchengemeinderäte, die ihre Orgel zu erhalten, umzubauen oder durch einen Neubau zu ersetzen haben …“ (KLOTZ 9/1979, S. 5) )).
Schließlich sind doch auch die Orgelbauer als mögliche Leser des Buches vorgestellt: Nicht dass sie daraus unmittelbar technische Einzelheiten lernen könnten, aber sie können sich darüber orientieren, was von ihnen gefordert wird und was in der Orgelprobe auf sie zukommt.
Will man den Autor charakterisieren, so lässt sich am meisten mit der Aussage anfangen, dass hier ein Prüfer und Gutachter geschrieben hat, auch ein versierter Benutzer von Orgeln, aber kein Praktiker des Orgelbaus((Ein charakteristisches Indiz hierfür findet sich in dem Abschnitt über die Herstellung einer Windwaage (§ 20). Hier werden die Abmessungen eines rechteckigen Zinnblechs, das zu einem Rohrstück gebogen und verlötet werden soll, mit „9 Grad [Zehntel-Zoll] breit und 15 5/7 Grade lang“ angegeben. Nun gab es mit Sicherheit keinen Maßstab, auf dem Siebzigstel-Zoll eingetragen gewesen wären. Die Sache klärt sich auf, wenn man daran denkt, dass 22/7 der üblicherweise für die Kreiszahl π angenommene Wert war. 15 5/7 entsprechen dann genau 5π, und das Röhrchen mit diesem Umfang hat schlicht 1/4 Zoll Durchmesser. Die Angabe 15 5/7 macht nicht einer, der so ein Blech schon einmal vermessen und zugeschnitten hätte, sondern ein Geometer, der den Umfang theoretisch errechnet hat!)).
ZANGs „Vollkommener Orgelmacher“ ist in 4 Abschnitte gegliedert: Der einleitende erste breitet die „Vorgeschichte“ eines Orgelbaus aus: Festlegung der Größe, Disposition und, bis in letzte Einzelheiten, der Kontrakt mit dem Orgelbauer, mit vielen Vorverweisen auf den zweiten Abschnitt; für den Fall, dass es sich um den Umbau einer vorhandenen Orgel handelt, wird deren Untersuchung und Bewertung behandelt; eingefügt ist noch ein Exkurs in die Geschichte des Instruments seit der Antike – ein solcher Abschnitt gehört seit alters dazu.
Der umfangreiche zweite Abschnitt ist „Von der Orgelprobe“ überschrieben und enthält 15 Paragraphen (5 bis 19) über alle wichtigen Komponenten des Orgelbaues: Werkvertrag und Plan, Register, Bälge, Windproben, Windkanäle, Windladen, Metall- und Holzpfeifen, Zungenregister, Wellaturen, Kanzellen, Parallelen, Windstöcke, Spünde und Stimmung.
Im dritten Abschnitt wird das Problem der Orgelstimmung behandelt, das zu ZANGs Zeiten wegen des Übergangs zur temperierten Stimmung ein besonderes theoretisches Interesse hatte und das als praktisches Problem auch noch lange nach ZANG in Schriften für Kantoren und Lehrer behandelt worden ist((z.B. TÖPFER 1865; das Buch ist laut Untertitel „für Organisten und Landschullehrer“ bestimmt, die ihre Orgel selber pflegen müssen.)).
Der vierte Abschnitt enthält ein Verzeichnis der zu dieser Zeit bekannten Orgelregister und gibt Hinweise für den Organisten zum rechten Gebrauch.
Ein Anhang enthält, wieder dem Brauch folgend, noch einige Dispositionen und zwei Kupfertafeln.
Der erste Zweck dieses Aufsatzes ist natürlich, dem Leser ZANGs Buch vorzustellen. Darüber hinaus möchte ich mich besonders mit den Teilen befassen, die ZANG als seine eigenen Erfindungen hervorhebt, nämlich der Stimmpfeife und seinem kombinatorischen Versuch zur Registrierung. Auch soll noch der Frage nachgegangen werden, ob ZANG schon eine quasi romantische Orgel propagiert. Es geht um die Frage, in welche Epoche er nun eigentlich gehört: Einige Stellen sprechen dafür, dass er sich von der Barockorgel distanziert, und sie sind einem heutigen, eher der Orgelbewegung verpflichteten Leser ein rechtes Ärgernis. Andererseits bleibt ZANG in seiner Musterdisposition und in vielen andern Einzelheiten recht konventionell. Das „ZANG-Problem“, ob der Mainstockheimer Kantor wirklich Bach-Schüler war oder nicht, wird sich damit freilich nicht lösen lassen.